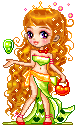Die Menschen sind nicht von gleicher Art; darum ist auch das nicht gleich, was sie Glück nennen.
Hermann von Schmid
Zitate, Gedichte von Hermann Theodor Schmid, ab 1876 Ritter von Schmid (1815-1880) deutscher Schriftsteller.
.................................................................................................................................
Es gibt nur eine Würze, die irgend etwas zum edlen, menschlich würdigen Genusse machen kann, es ist das Bewusstsein, dafür gearbeitet, ihn durch Mühe erkauft zu haben.
Man kann den Menschen nicht bloß aus den Gesichtszügen oder aus der Handschrift beurteilen; die Art und Weise, wie ein Mensch sein Zimmer einrichtet, die Ordnung, die er darinnen hält, sind eine nicht minder leserliche, eine nicht minder sichere Handschrift und in Zügen, die kaum zu missverstehen sind.
Ich hatt‘ ein Vöglein, das war wunderzahm,
dass es vom Munde mir das Futter nahm.
Es flatterte bei meinem Ruf herbei
und trieb der muntern Kurzweil vielerlei,
drum stand das Türchen seines Kerkers auf
den ganzen Tag zu freiem Flug und Lauf.
Im Käfig war es aus dem Ei geschlüpft,
war nie durch Gras und grünes Laub gehüpft
und hatte nie den dunklen Wald geschaut,
wo sein Geschlecht die leichten Nester baut.
Und wie der Winter wieder kam ins Land,
das Weihnachtsbäumchen in der Stube stand,
da fand mein schmuckes, zahmes Vögelein
neugierig bald sich in den Zweigen ein.
Wohl trippelt es behutsam erst und scheu
dem Rätsel zu, so lockend und so neu,
doch bald war’s in dem grünen Reich zu Haus,
wie prüfend breitet es die Flügel aus;
so freudig stieg und fiel die kleine Brust,
als schwellte sie der Tannenduft mit Luft.
Und wie er nie vom Käfig noch erklang,
so froh, so schmetternd tönte sein Gesang!
Zum erstenmal berauscht vom neuen Glück,
kehrt es zu seinem Hause nicht zurück.
Hart an das Stämmchen duckt es, still und klein
und schlummert in der grünen Dämmrung ein.
Und sinnend sah ich lang des Lieblings Ruh
wie erst dem Spiel, dem zierlich heitren, zu,
als durch des Vogels Leib mit einemmal
sein seltsam Zittern wunderbar sich stahl;
das Köpfchen mit dem Fittich zugetan,
fing es geheim und süß zu zwitschern an:
Im Traum geschah’s … und Wald und Waldeswehn
schien ahnungslos durch diesen Traum zu gehen.
Und seltsam überkam’s mich bei dem Laut!
Was nie das Tierchen lebend noch geschaut,
des freien Waldes freie Herrlichkeit,
nun lag es offen da vor ihm und weit …
mich aber mahnt es einer anderen Welt,
und mancher Frage, zweifelnd oft gestellt,
und dieses Leben deuchte mir ein Traum
wie der des Vögleins auf dem Weihnachtsbaum.
Hermann von Schmid (1815-1880)
Du befindest Dich in der Kategorie: :: Hermann von Schmid :: Sprüche, Gedichte, Zitate
Anpassung und Design: Gabis Wordpress-Templates
Impressum & Haftungsausschluss & Cookies :: Sitemap :: Sprüche, Zitate und Gedichte - kostenlos auf spruechetante.de